Pädagogik und Psychologie
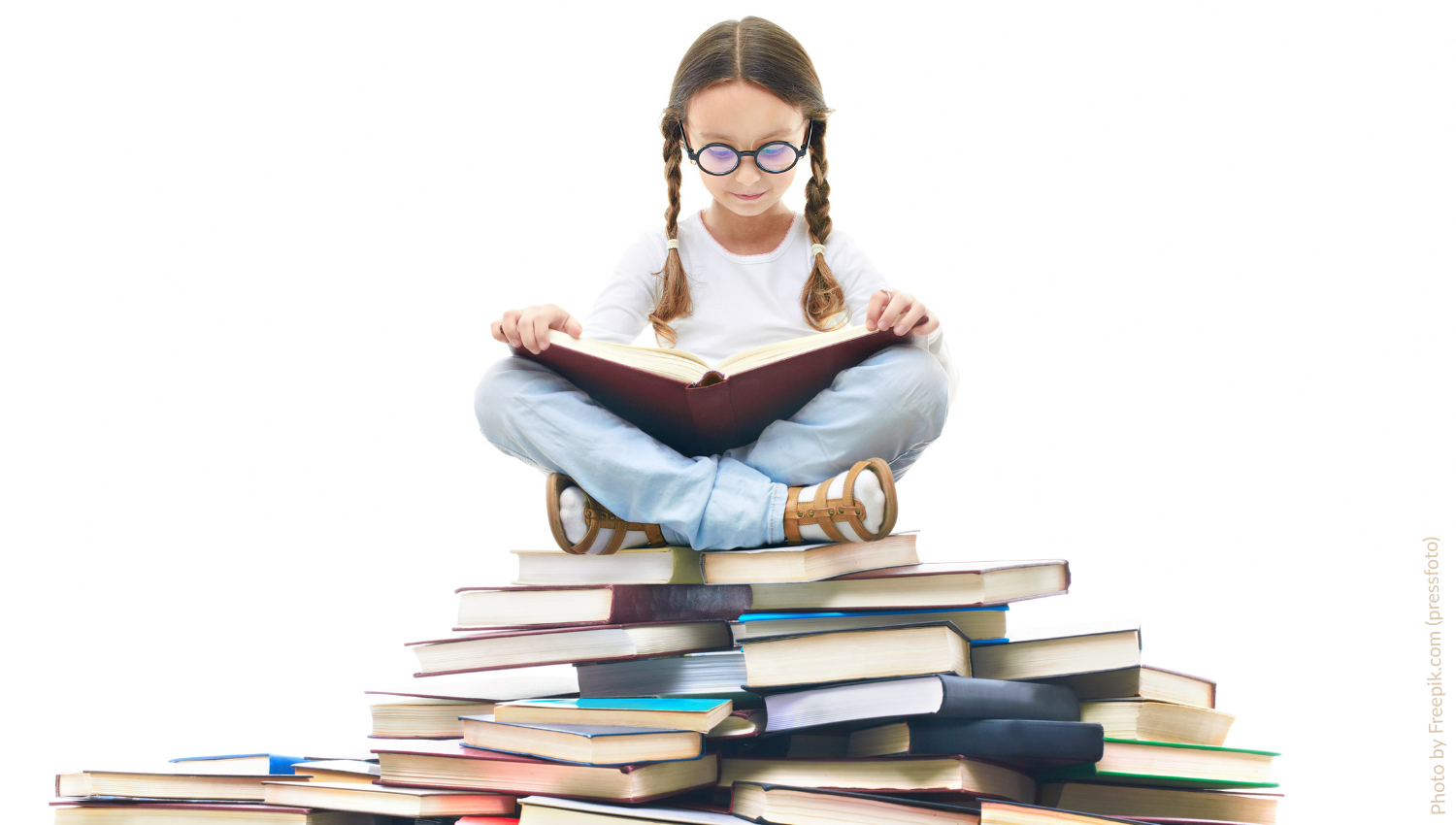
Intrinsische oder extrinsische Motivation beim Lernen
„Von innen heraus …“ – Müssen Kinder (immer) intrinsisch motiviert sein, um erfolgreich zu lernen?von Dr. Lorenz Huck
Selbstvergessen übt Josie schon seit einer halben Stunde, mit drei Bällen zu jonglieren. Endlich gelingt es ihr, die Bälle mehrfach hintereinander in der Luft zu halten! Ihr breites Grinsen zeigt, wie glücklich sie über diesen Erfolg ist ... Kim will vor der Schule unbedingt noch in sein neues Sachbuch über Dinosaurier schauen. Die Eltern müssen mehrfach erinnern, dass es nun wirklich Zeit zum Losgehen ist. Erst in letzter Sekunde legt er das Buch widerwillig beiseite … Zum Glück gibt es im Alltag viele Situationen, in denen Kinder von sich aus, also ohne (erkennbaren) Anreiz von außen, etwas lernen möchten. Gründe dafür können zum Beispiel – wie bei Josie – der Spaß an der Aktivität oder – wie bei Kim – Wissbegier sein.
Unter Fachleuten spricht man in diesem Fall von „intrinsischer Motivation“. Dieser Begriff wird mittlerweile auch in der Alltagssprache häufig verwendet: Niemand würde sich wundern, wenn ein Fußballtrainer oder eine Verkaufsleiterin sich darüber Gedanken machen, warum es ihren Teams an intrinsischer Motivation fehlt. Auch Eltern und Lehrkräfte gebrauchen den Begriff.
Positives Vorurteil oder doch mehr?
Im Alltag wird intrinsisch motiviertes Lernen nicht selten mit positiven Vorurteilen belegt: Es wird zum Beispiel angenommen, dass intrinsische Motivation zu besseren oder nachhaltigeren Lernergebnissen führe. Manchmal hört man auch, dass nur intrinsische Motivation selbstbestimmtes Lernen ermögliche.
Aber stimmt das wirklich? Bei näherer Betrachtung sind Zweifel berechtigt. Die wohl einflussreichsten Motivationsforscher der letzten Jahrzehnte, Edward L. Deci und Richard M. Ryan, haben im Rahmen ihrer sogenannten „Selbstbestimmungstheorie“ der Motivation unter anderem die Frage verfolgt, wie verschiedene Arten extrinsischer Motivation mit Selbst- und Fremdbestimmung zusammenhängen.
Ihren Überlegungen zufolge gibt es auf der einen Seite Formen der extrinsischen Motivation, bei denen Menschen sehr stark fremdbestimmt sind, weil sie von dem Wunsch nach einer Belohnung oder der Furcht vor Strafe beherrscht werden (Deci und Ryan bezeichnen dies als „externe Regulation“). Auf der anderen Seite stehen aber Formen der extrinsischen Motivation, bei denen man Ziele verfolgt, die einem wichtig sind, und im Einklang mit den eigenen Werten bleibt. Zum Beispiel könnte es sein, dass sich ein Schüler für die Fremdsprache Latein entscheidet, weil er später einmal Medizin studieren und die medizinische Fachsprache besser verstehen möchte. Die Motivation für das Erlernen von Vokabeln und Grammatik ist in diesem Fall extrinsisch. (Zumindest ist es nicht unbedingt wahrscheinlich, dass die Tätigkeit des Vokabellernens für sich genommen großen Spaß macht.) Dennoch wird der Schüler regelmäßig, mit entsprechend gutem Erfolg und in völligem Einklang mit seinem Lebensentwurf üben (Deci und Ryan sprechen hier von „identifizierter“ oder „integrierter Regulation“).
Eine entlastende Erkenntnis
In zahlreichen Studien konnte man nachweisen, dass selbstbestimmte Formen der extrinsischen Motivation und der intrinsischen Motivation gleichermaßen zu guten Lernergebnissen und guten Leistungen führen.
Diese Erkenntnis kann auch entlasten: Oft ist es gar nicht möglich, intrinsische Motivation aus dem Nichts zu erzeugen. Kinder, von denen man erwartet, dass sie aus sich heraus neugierig auf schulische Themen sind, können sich überfordert fühlen und gerade deshalb die Beschäftigung mit diesen Themen ablehnen. Lehrende, die positive Vorurteile zur intrinsischen Motivation haben, fühlen sich möglicherweise genötigt, jeden Lerninhalt in eine spielerische Form zu kleiden – mit der Gefahr, dass der Zusammenhang von Spielidee und Inhalt oberflächlich bleibt, der beabsichtigte Effekt nicht eintritt oder sich sogar ins Gegenteil verkehrt.
Gibt man positive Vorurteile auf, werden andere Wege sichtbar, Motivation zu entwickeln: Hat sich ein Kind zum Beispiel in der Lerntherapie selbst Ziele gesetzt (oder kann es sich mit vorgeschlagenen Zielen identifizieren), so wird es im Allgemeinen bereit sein, zum Erreichen dieser Ziele Mühen auf sich zu nehmen.
Im Idealfall ergänzen und unterstützen sich die unterschiedlichen Quellen der Motivation gegenseitig.
Literatur:
Deci, Edward L.; Ryan, Richard M.: Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. In: Zeitschrift für Pädagogik 39 (1993) 2, S. 223–238
Über den Autor:

Dr. Lorenz Huck ist Geschäftsführer und Fachbereichsleiter Interdisziplinäre Integration der Duden Institute für Lerntherapie.
Meist gelesen




